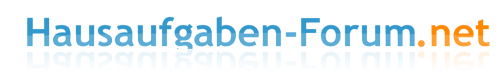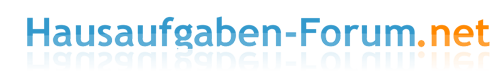Hallo, wenn mir jemand meine Analyse auf grammtische und vielleicht auch ein paar inhaltliche Fehler korrigieren würde, wäre es klasse ![]()
Die Rede kann man hier nachlesen:
http://archiv.bundesregierung.de/ContentArchiv/…kel-jugend.html
allerdings sind einige Teile im Unterrichtsmaterial gestrichen worden.
Vielen Dank!
Der vorliegende Redeausschnitt ist von Angela Merkel, der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Sie bekleidet seit November 2005 dieses Amt und ist bereits in ihrer dritten Amtsperiode. Außerdem ist sie die Bundesvorsitzende der CDU. Die Kanzlerin hält diese Rede am 16. April 2012 auf dem jährlichen Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt. Dieser Gipfel ist eine Maßnahme um die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund voranzutreiben. Das Publikum besteht aus insgesamt 100 ausgewählten Jugendlichen, unter denen sich 50 mit offensichtlichem Migrationshintergrund und 50 mit ausländischen Wurzeln befinden. Die anwesenden Jugendlichen erwarten von der Rede eine bessere Eingliederung in die Gesellschaft. Dabei stehen die Jugendlichen der Politikerin möglicherweise kritisch gegenüber, da sie vielleicht eine generelle Ablehnung zu Politikern empfinden oder ihre Ideale mit denen der Politiker nicht überein stimmen. Trotz dieser Differenzen ist das Publikum größtenteils der gleichen Meinung wie die Rednerin, wobei die Politikerin versucht, die restlichen Jugendlichen von ihrer Meinung zu überzeugen. Die Rede wurde in einem eher umgangssprachlichen Wortgebrauch verfasst, so dass sie leicht verständlich für die Jugendlichen ist. Angela Merkel benutzt kaum Fachwörter und bei komplizierten Passagen beziehungsweise Wörtern liefert sie sofort eine Erklärung. Außerdem spricht Angela Merkel viele Ich-Botschaften aus, damit sich die Jugendlichen mit ihr identifizieren können. Wenn die Rednerin Forderungen verfasst siezt sie ihr Publikum, um ihm zu zeigen, dass es von ihr ernst genommen wird.
Die Rede lässt sich in 7 Abschnitte gliedern. Im ersten Teil versucht Angela Merkel die Jugendlichen auf ihre Seite zu bringen und sie aufmerksam zu machen. Dies erreicht sie mit der Abwertung der Begriffe “Integration” und “Migrant”. Die Jugendlichen finden diese Bezeichnungen wahrscheinlich ebenfalls unpassend. Die Politikerin möchte das Redethema einleiten und klarstellen, dass sie dem Problem Integration ebenfalls kritisch gegenübersteht. Sie will die Erfahrungen der Zuhörer in Erfahrung bringen und hebt deren Erfahrungen mithilfe einer Aufwertung als wichtig hervor. Danach stellt sie politische Aktionen, welche zur Integration beitragen können, als Lösungsweg in den Vordergrund und erläutert diese Aktionen sofort mithilfe von rhetorischen Fragen, die sie selbst beantwortet. Damit will sie die Problematik eingrenzen und zeigen, was alle erreichen können, wobei sie sich selbst mit einbezieht. In den folgenden Sätzen nutzt sie das Personalpronomen “wir” in Verbindung mit dem Modalverb “können”(Z. 8 ff) und stellt Parallelismen auf. Die Vorschläge sollen als Lösungsvorstellungen dienen, sie möchte jedoch nur eine Möglichkeit bieten und keine Vorgaben erstellen. Damit erreicht sie eine Beschwichtigung und stellt sich auf die Zuhörerebene. Weiterhin wiederholt sie das Verb “kümmern” (Z. 10 ff) um klarzustellen, dass alle etwas tun müssen, um auch etwas zu erreichen. Am Ende des Abschnittes appelliert sie an den Willen der Menschen zur Veränderung. Der zweite Abschnitt beginnt damit, dass die Rednerin ihr Publikum vorstellt. Dabei teilt sie es in zwei Kategorien und zwar in offensichtliche Migranten und in nicht offensichtliche Zuwanderer. Dann stellt sie am Beispiel des Verteidigungsministers Thomas de Maizière klar, dass es keine genaue Trennung zwischen Migranten und Einwohnern geben kann, weil die Kinder vergangener Migranten nicht genau als Zuwanderer oder Einwohner bezeichnet werden könne. So werden die Politiker mit dem Publikum auf eine Stufe gestellt, um die Regierung nicht aus der Problematik auszugrenzen. Im zweiten Abschnitt stellt sie rhetorische Fragen, zum Beispiel ab wann und wie man als Migrant bezeichnet werden kann. Hier beantwortet sie sofort ihre eigenen Fragen. Das hat die Funktion, den Zuhörern ihre Fragen zu beantworten, ohne dass die Zuhörer überhaupt fragen müssen. Damit erlangt sie die Aufmerksamkeit ihres Publikums, da dieses sich von ihr angesprochen fühlt. Bei dem Beispiel wäre die Antwort, dass im Grunde jeder ein Migrant ist, da die Migration an sich ein fließender Prozess ist. Nichtsdestotrotz teilt sie das Publikum in zwei Lager um deren völlig verschiedene Lebenserfahrungen aufzuzeigen. Der Abschnitt ist gekennzeichnet durch den hypotaktischen Satzbau mit vielen Einwürfen im Satz. Dies hat eine erklärende Funktion, welche trotz komplizierterem Satzbau leicht verständlich ist. Die Hauptaufgabe dieses Absatzes ist, die Migration als Aufgabe aller zu kennzeichnen. Im dritten Abschnitt benutzt Frau Merkel den Anglizismus “Workshops” (Z.39) um zur jüngeren Generation, welche diese Entlehnungen sehr oft benutzt, dazu zu gehören. Es ist ein neuer Versuch, mit den Zuhörern auf einer Ebene zu sein. Weiterhin bittet sie um weitere Erfahrungen des Publikums und die Möglichkeit, diese zu teilen, indem sie die Wortgruppe “Ich bitte Sie” (Z.41 f) wiederholt und im Anschluss Argumente aufzählt. Damit möchte sie die Offenheit der Zuhörer anregen und, wie in den nächsten Sätzen klar wird, auch die Ängste vor Ablehnung schüren. Sie stellt nämlich klar, dass es keine dummen Fragen gibt und sich keiner darum sorgen soll. Auch hier bringt sie immer auch gleich einen Lösungsvorschlag zu gewissen Problemen der Integration. Im 4. Abschnitt erläutert sie, wie man sich der Problematik nähern soll. Man soll in einem Gespräch offen von seinen Erfahrungen berichten. Damit nennt sie erneut das Ziel, welches sie bei ihrem Publikum erreichen will. Es ist ihr sehr wichtig, dass dieser Fakt nicht in den Hintergrund gerät. Weiterhin spricht sie die Problematik Klischees an und definiert diesen Begriff für ihr junges Publikum, da sie nicht in Klischees denken sollen. Bei der Erläuterung des Begriffes nimmt sie sich selbst in die Wertung mit ein, indem sie das Wort “man” (Z. 55) benutzt und Zugeständnisse auf ihrer und auf der Zuhörerseite macht, indem sie “Man kann ja nicht alles [...] selbst erleben” formuliert. Auch hier benutzt sie in der Erklärung eher verschachtelte Sätze und doppelt sogar die Formulierung “was man selbst nicht erlebt hat” (Z.55 f und Z.57) damit wirklich jeder versteht was sie meint. Sie hebt eine bestimmte Einstellung gegenüber diesen Klischees heraus und gibt zugleich einen Rat für die Zuschauer, bei dem sie sich immernoch mit einbezieht. Im 5. Abschnitt hebt sie voraus, dass auch schlechte Erfahrungen geteilt werden sollen und erzählt nun ein Negativbeispiel aus ihrem eigenen Leben, um Zuhörernähe herzustellen. Sie spricht über offensichtlich fehlende Chancengleichheit in der Berufswelt für Migranten, obwohl diese wohl genauso gute Vorraussetzungen haben wie Deutsche. Sie erläutert also ihre eigene Erfahrung leicht verständlich und nennt ein konkretes Problem, um die Problematik glaubhafter zu machen. Im Gegensatz dazu erwähnt sie im 6. Abschnitt eine Erfahrung zu gelungene Integration, jedoch nicht in einem konkreten Beispiel. Sie gibt den Rat, dass die Zuhörer ihre Augen für Schwierigkeiten öffnen sollen. Auch hier macht sie gewisse Zugeständnisse, sieht also nicht nur positive Seiten, sondern auch negative. Das zeigt, dass sie durchaus fähig ist, sich Kritik zu stellen und nicht, wie es den Politikern oft vorgeworfen wird, “die Augen zu verschließen” (Z. 84). Diese Metapher soll verdeutlichen, dass sich keinem Problem gestellt wird. Sie stellt klar, dass es auch Ablehnung von Seiten der Migranten gibt, da Deutsche, die in türkische Kinofilme gehen, gefragt werden “Was willst du denn hier?” (Z. 86 f.) Dieses Beispiel steht im Gegensatz zu ihrer ersten Erfahrung. Erst jetzt nennt sie den konkreten Begrif für diese Phänomene, über die sie in den vorigen und in diesem Abschnitt berichtet/hat, nämlich “Parallelwelten” (Z. 90). Hätte sie ihn früher genannt, hätte das Publikum möglicherweise nichts damit anfangen können, doch nach diesen zwei Beispielen wird den Begriff jeder nachvollziehen können. Nochmals bittet sie um die Mithilfe der Jugendlichen und bezeichnet deren Meinung sogar als “wichtiger Beitrag” (Z. 93). Damit wiederholt sie die Aufforderung vom Anfang ein weiteres Mal, um den Zuhörern zu verdeutlichen, dass deren Erfahrungen wirklich sehr wichtig sind und um die Aufforderung nach Kommunikation bei ihnen einzuprägen. Dass die Meinungen für die Politik sehr wichtig sind, erzeugt im Publikum eine Form der Aufwertung. Den letzten Abschnitt nutzt Angela Merkel um ihr Schlusswort an die Jugendlichen zu richten. Sie erwähnt, dass die Aufgabe der Migration auch morgen noch besteht und sie Berichte über die Erfahrungen der Jugendlichen haben will, was wie eine leichte Drohung klingt. Damit will sie ihrer Bitte Nachdruck verleihen und da sie es etwas negativ formuliert, kann man es als eine Form der Abwertung interpretieren. Gleich darauf beschwichtigt sie ihr Publikum mit der “Hoffnung” (Z. 98) auf Kommunikation, welche sie hat. Sie erläutert die Aufgabe der Zuschauer als Multiplikatoren eingehend. Sie benutzt jedoch erstmal nicht diesen Begriff, da ihn das Publikum möglicherweise nicht verstehen würde, sondern sagt nur, dass jeder seine Erfahrungen und Überzeugungen weiter erzählen soll. Wie zuvor schon, nennt sie die konkrete Bezeichnung erst nach ihrer Erläuterung. Sie verneint das Sprichwort “Reden ist Silber, Schweigen ist Gold” (Z. 105), damit die Zuhörer wissen, was sie nicht machen sollen und um der gestellten Aufgabe Nachdruck zu verleihen. Sie stellt zwar die Aufforderung, jedoch zwingt sie niemanden, sondern stellt klar, dass die Aufgabe für die Zuschauer freiwillig ist, aber von ihrer Seite sehr erwünschenswert.