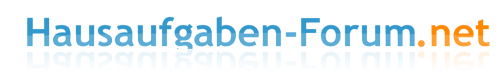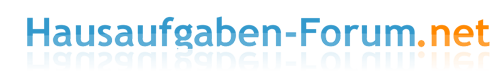Zu 1)
NH3 gehört zur Stoffklasse der Basen im Sinne von Brönsted. Ich weiß aber nicht, ob ihr so weit in Chemie bereits seid, dass Du mitr diesem Begriff etwas anfangen kannst. Das Eiweiß ist eine Stoffklasse für sich. Jeder Eiweißkörper hat eine andere Formel.
Die anderen Stoffe sind entweder Elemente (siehe Periodensystem), Salze, ein Hydroxid oder eine Säure. Findest Du die Zuordnung?
Zu 2)
Der Stoff, den ich meine, ist fest. Weißt Du jetzt welchen Stoff ich meine?
Zu 3)
In einem metallischen Leiter befindet sich ein Elektronengas. Dabei können die Elektronen in Wechselwirkung mit den schwingenden Metallatomen geraten.
Je nachdem, ob diese Wechselwirkung mit steigender Temperatur größer oder kleiner wird, unterscheidet man zwischen Kaltleitern oder PTC (Widerstandswert steigt, prinzipiell bei allen Metallen) und Heißleitern oder NTC (Widerstandswert sinkt).
Zu 4)
Informiere Dich bei google zum Thema < amalgam>.
Zu 5)
Metallkristalle sind aufgebaut aus Metallkationen auf festen Gitterplätzen und delokalisierten Elektronen, die die metallische Bindung und damit den Zusammenhalt des Gitters bewerkstelligen. Man spricht von einer metallischen Bindung.
Das Kristallgitter der Ionenkristalle besteht aus positiv und negativ elektrisch geladenen Ionen, die sich gegenseitig stark anziehen. Man spricht von einer Ionenbindung.
Zu 6)
Auch hier sollst Du google bemühen und eingeben < modifikationen des kohlenstoffs > oder vielleicht zuerst < modifikationen >.
Zu 7)
2 Mg + O2 --> 2 MgO
Bei der Reaktion zwischen Aluminium und dem Gas Chlor wird AlCl3 (Aluminiumchlorid) erhalten. Schaffst Du die Reaktionsgleichung?